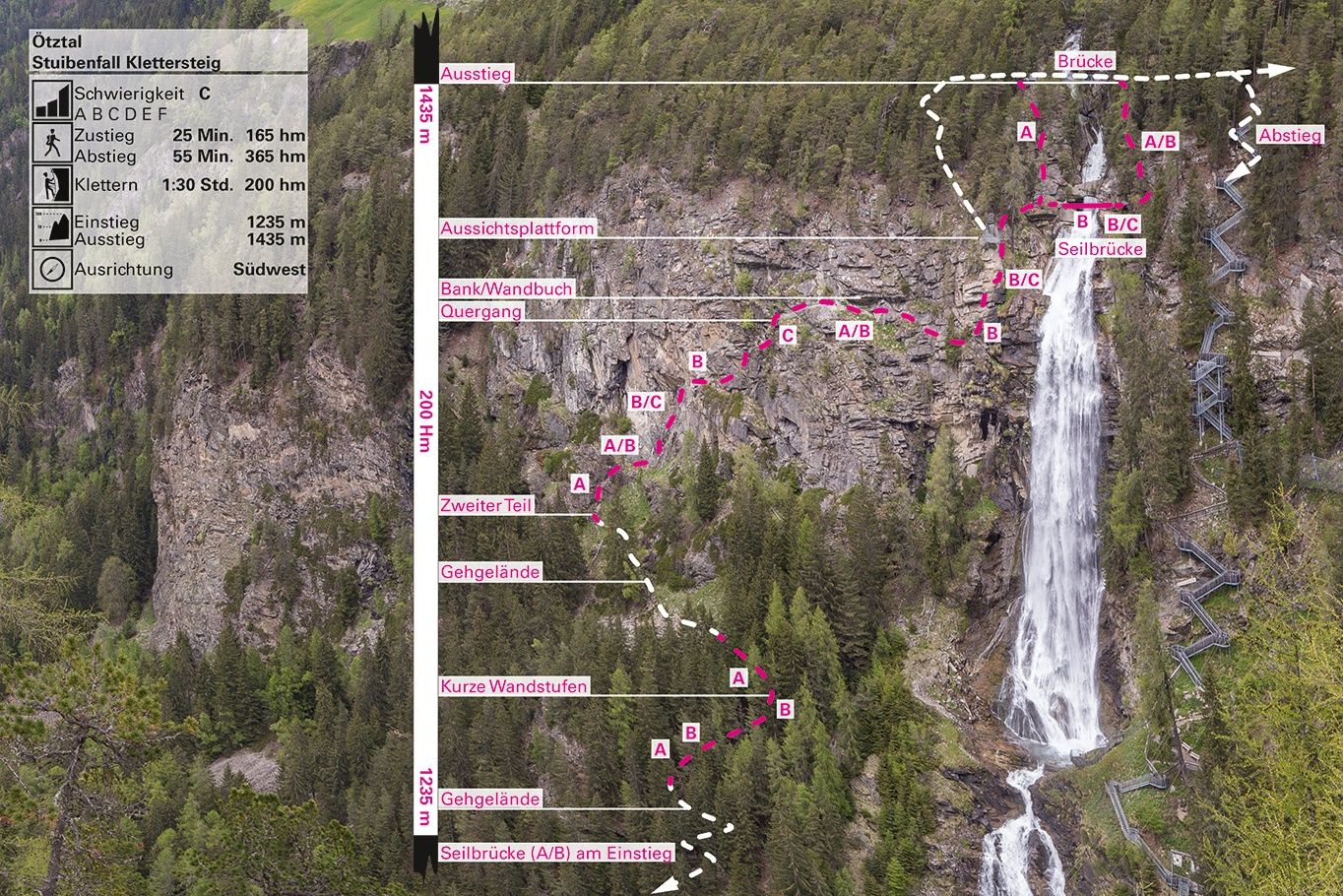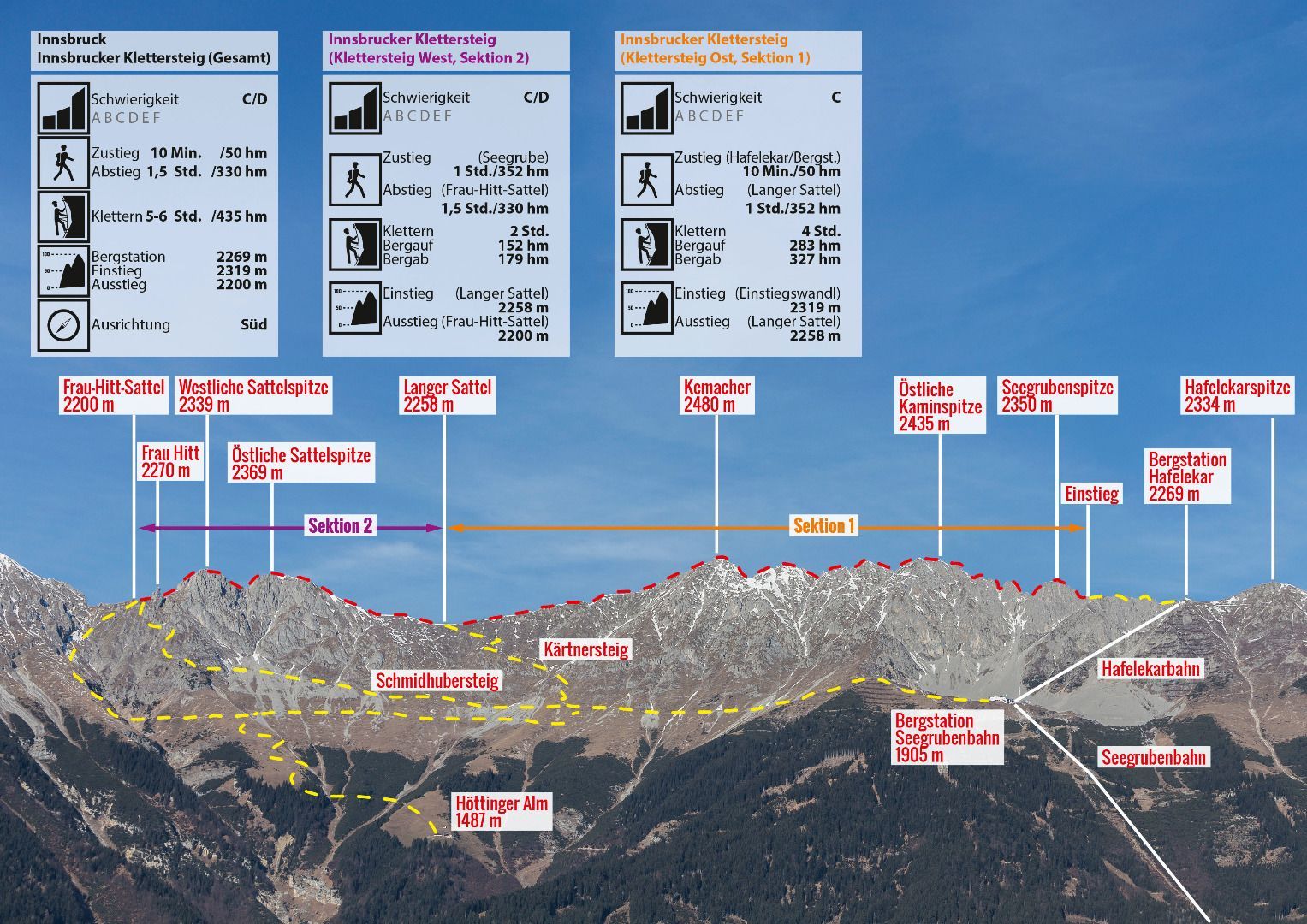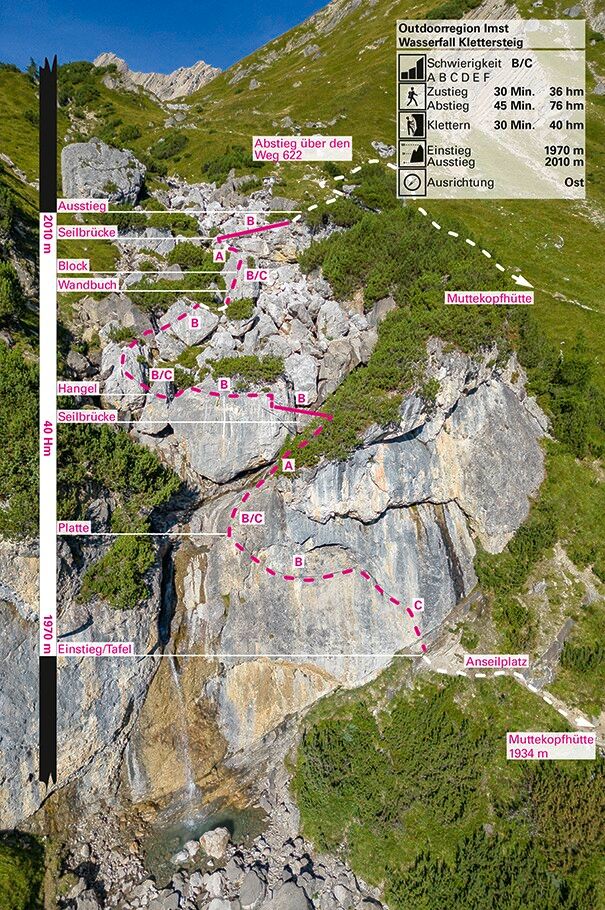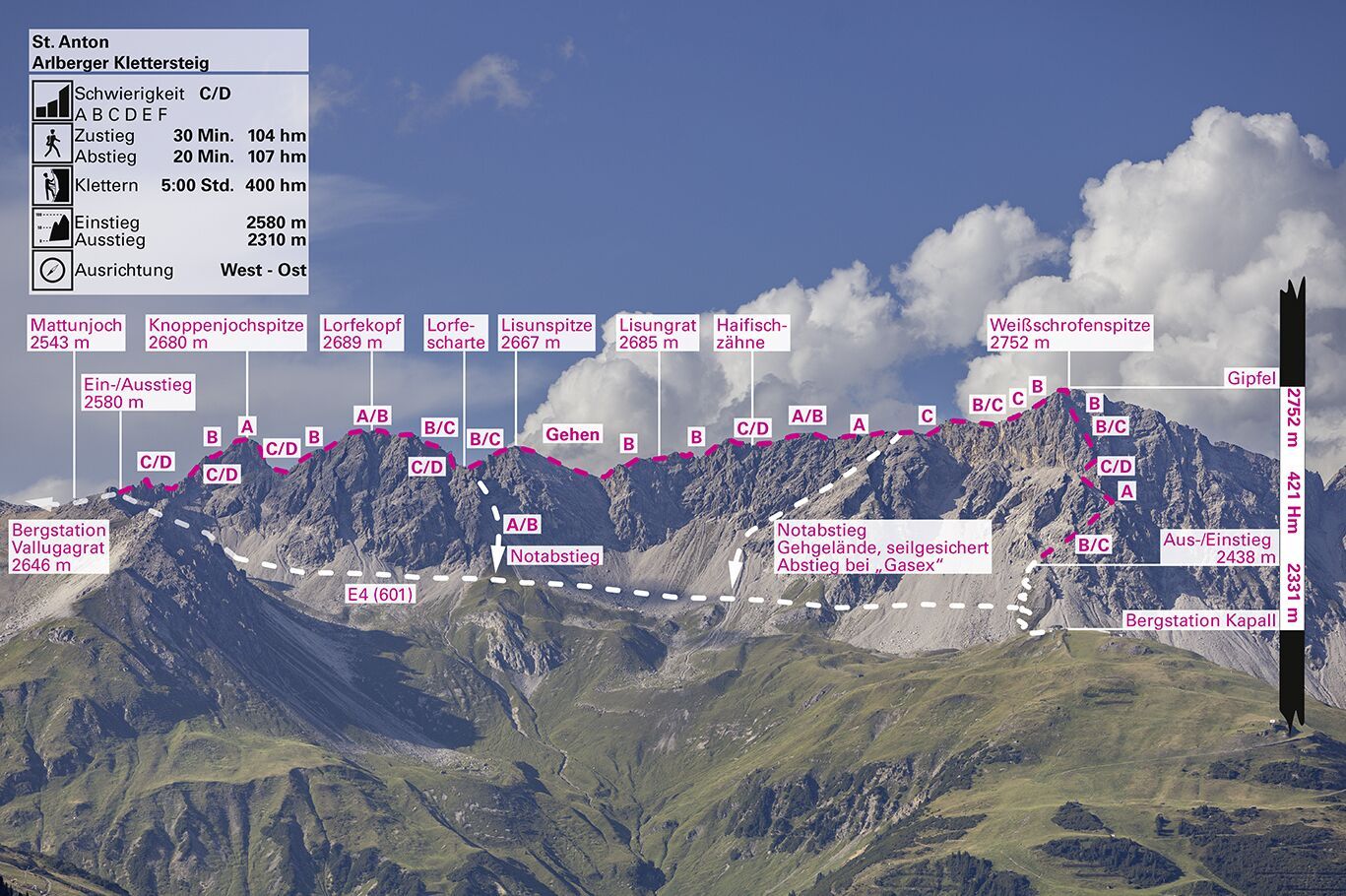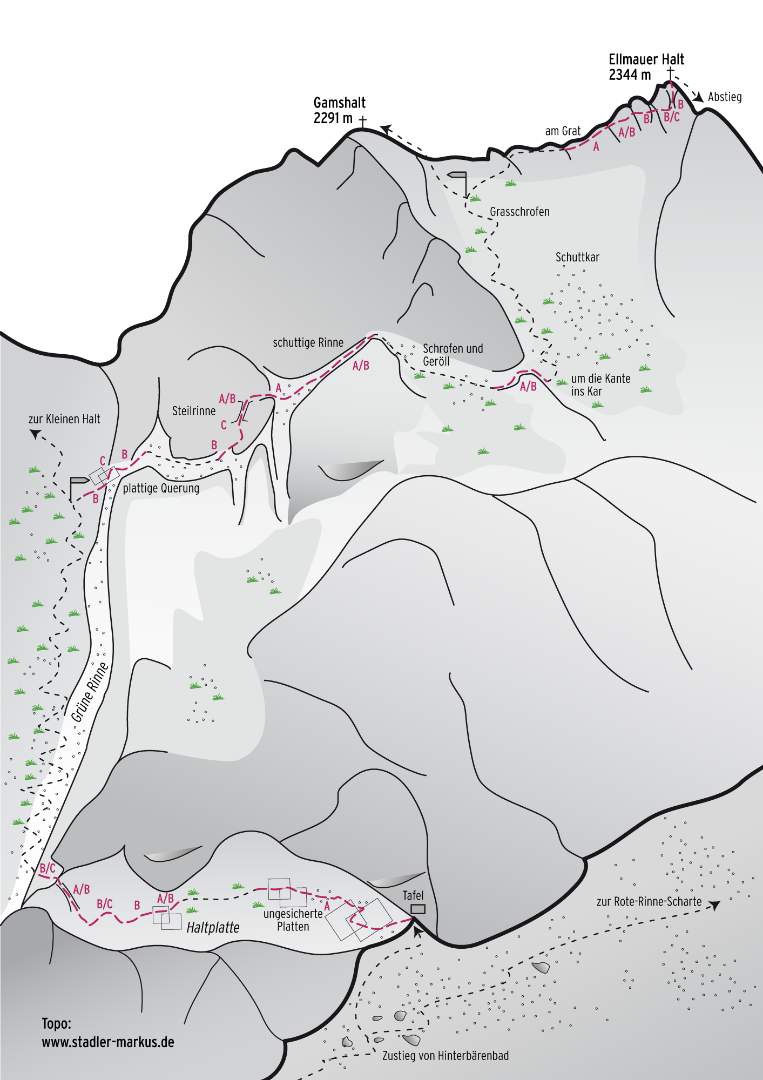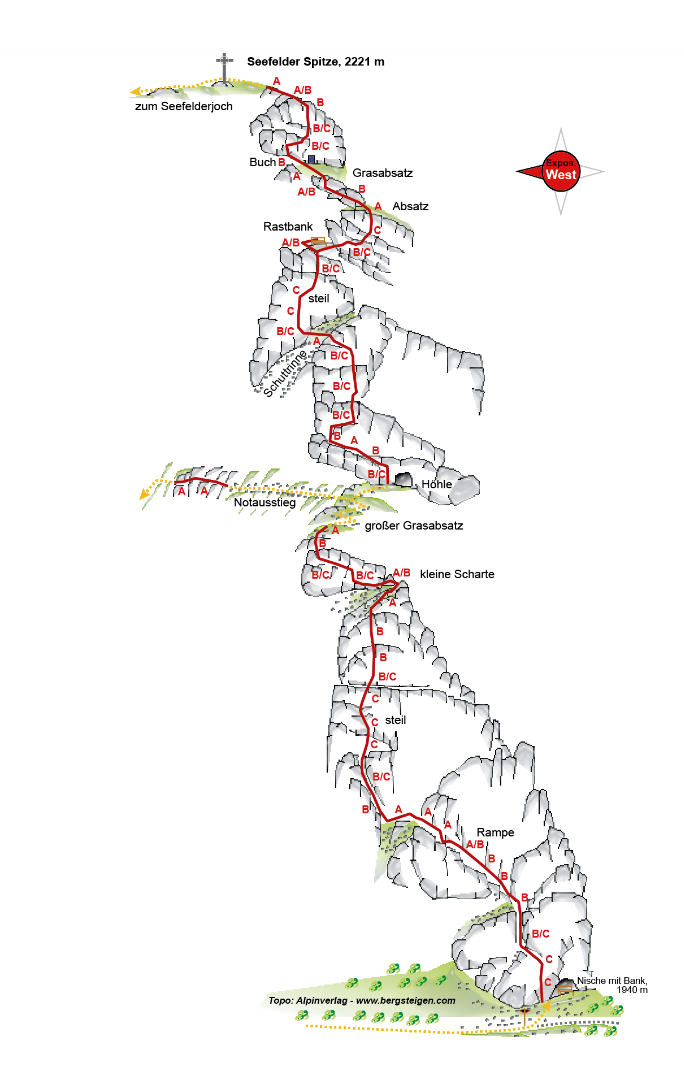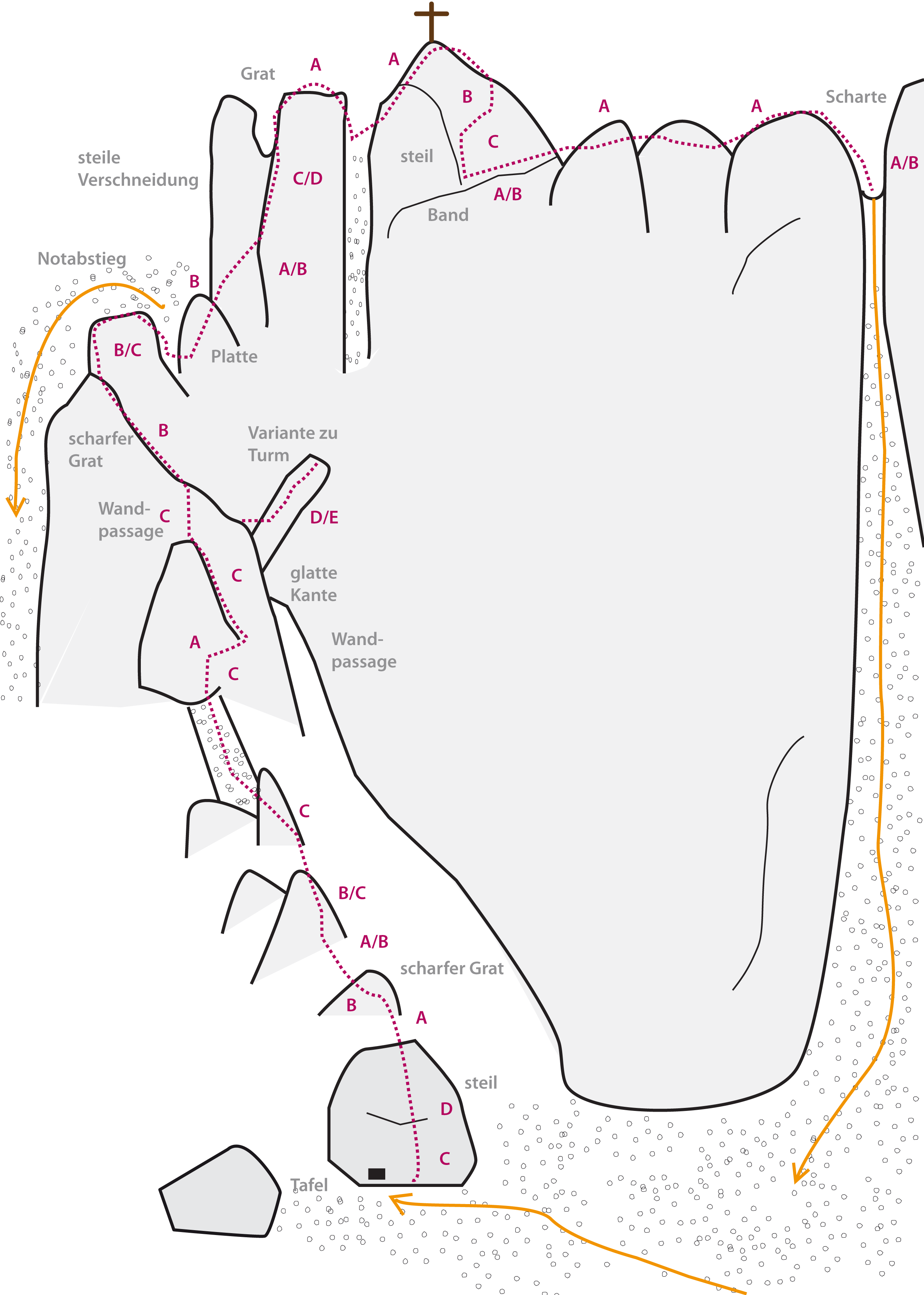Bergsteigen hat in der Regel einen oder mehrere Gipfel als Ziel, wobei auch Kletterausrüstung zum Einsatz kommen kann. Im Gegensatz dazu steht beim Klettersteig das Klettererlebnis im Mittelpunkt. Ein Klettersteig in Tirol kann, muss aber nicht auf einen Berggipfel führen. Er lässt sich definieren als gesicherter Steig mit Drahtseilen und Tritten. Die Eigensicherung mit Klettersteigset, zu der ein Klettergurt, ein Fangstoßdämpfer, mindestens zwei Seilschlingenäste mit Karabinerhaken und Helm gehören, ist das A und O.